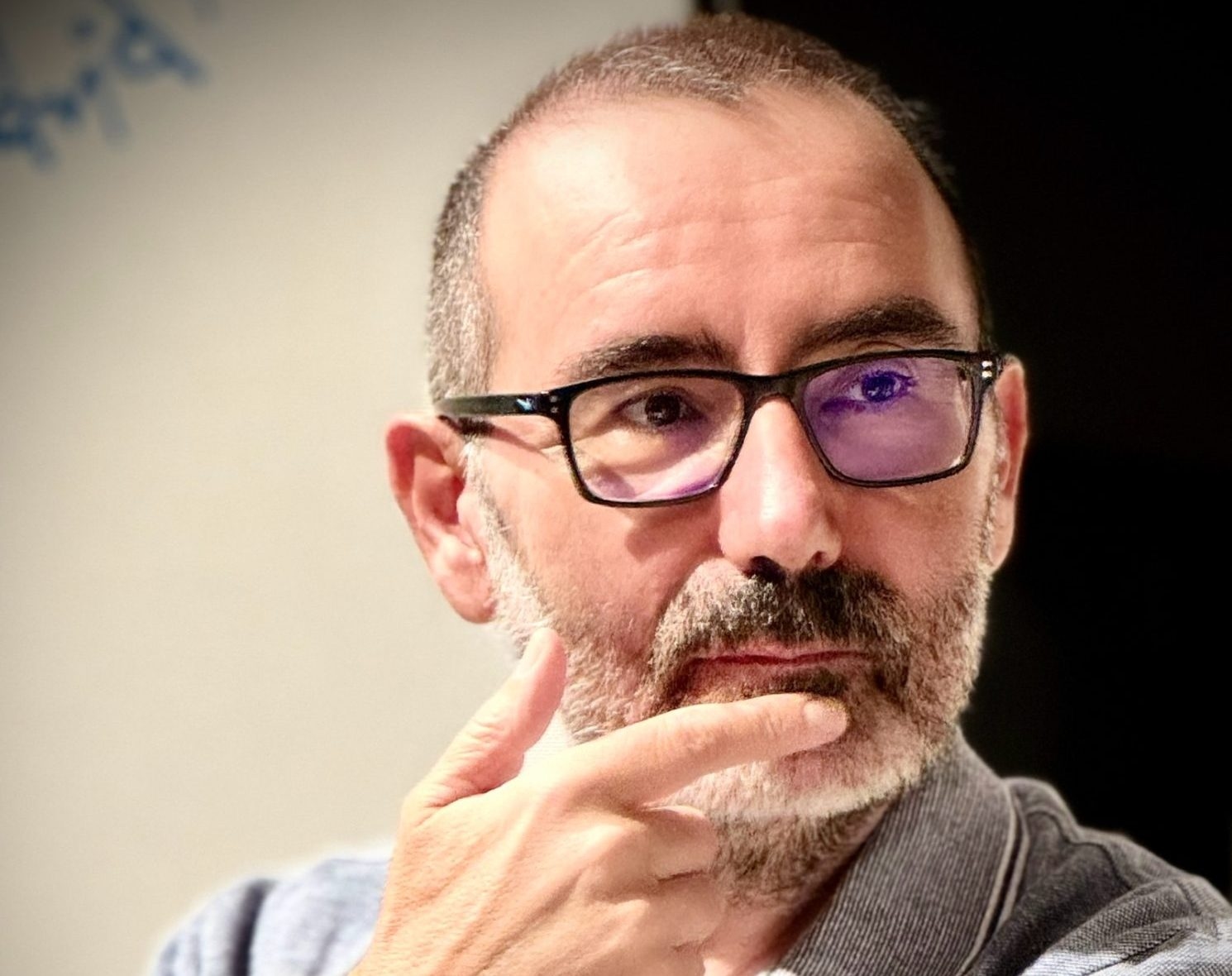Kohlenstoffemissionen: Die reichsten 0,1 % der Weltbevölkerung emittieren 32 % mehr, während die ärmsten 50 % 3 % weniger emittieren.

Laut einem Bericht von Oxfam Intermón hat das reichste 0,1 % der Weltbevölkerung seinen Anteil an den Kohlenstoffemissionen seit 1990 um 32 % erhöht, während die ärmere Hälfte der Menschheit ihn im gleichen Zeitraum um 3 % reduziert hat.
Eine Person aus dem reichsten 0,1 % der Bevölkerung verursacht an einem einzigen Tag mehr Umweltverschmutzung als eine Person aus der ärmsten Hälfte im ganzen Jahr. Würde jeder so viel CO₂ ausstoßen wie die reichsten 0,1 %, wäre das CO₂-Budget laut dem Bericht „Klimaplünderung: Wie eine mächtige Minderheit die Welt in den Abgrund führt“ in weniger als drei Wochen aufgebraucht.
Laut dieser internationalen Kooperations-NGO müssten die Superreichen ihren CO2-Fußabdruck bis 2030 um 99 % reduzieren, um zu verhindern, dass die globale Erwärmung 1,5 Grad übersteigt – das Ziel des Pariser Abkommens.
Seit diesem Abkommen im Jahr 2015 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr als das Doppelte des Kohlenstoffbudgets der ärmeren Hälfte der Menschheit insgesamt verbraucht.
Oxfam Intermón veröffentlicht diese Daten – eine Woche vor Beginn des Klimagipfels (COP30) im brasilianischen Belém – um zu unterstreichen, dass „der kohlenstoffintensive Lebensstil der Superreichen das verbleibende Kohlenstoffbudget der Welt aufzehrt, also die Menge an CO2, die emittiert werden kann, ohne eine Klimakatastrophe auszulösen.“
Der Bericht hebt hervor, dass „die durchschnittliche superreiche Person“ durch ihre Investitionen jährlich 1,9 Millionen Tonnen CO2 produziert.
„Es bedarf fast 10.000 Reisen um die Welt mit ihren Privatjets, um einen solchen Betrag aufzubringen“, heißt es in dem Dokument.
Die NGO schätzt außerdem, dass die Emissionen des reichsten 1 % der Bevölkerung „ausreichen, um bis zum Ende des Jahrhunderts etwa 1,3 Millionen hitzebedingte Todesfälle zu verursachen sowie bis 2050 einen wirtschaftlichen Schaden von 44 Billionen Dollar in Ländern mit niedrigem und unterem mittlerem Einkommen anzurichten.“
Die Diskrepanz bei den Emissionen hat „katastrophale Folgen“, insbesondere für die Bewohner des globalen Südens, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, und unter ihnen ganz besonders für Frauen, Mädchen und indigene Gruppen.
Der Bericht spricht von sechs daraus resultierenden Krisen: Hunger, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Geschlechterfragen und Menschenrechte.
Darin wird auch betont, dass „der Bankensektor einer der Hauptschuldigen der Klimakrise ist“, vor allem aufgrund der Finanzierung neuer Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe.
Daher geht sie davon aus, dass die drei umweltschädlichsten Unternehmen in Frankreich allesamt Banken sind: BNP Paribas, Crédit Agricole und Société Générale.
Spanien, dasselbe MusterIn Spanien verursacht eine Person aus dem obersten 0,1 % der Einkommensbezieher einen 55-mal so hohen CO₂-Fußabdruck wie eine Person aus dem untersten 50 % der Einkommensbezieher, wie die NGO hervorhebt. Um nachhaltige Werte zu erreichen, müsste Spanien seine Emissionen bis 2030 um 99,4 % reduzieren.
Oxfam Intermón erinnert an den Sturm vom Oktober 2024, um zu betonen, dass „extreme Wetterphänomene die Ärmsten am härtesten treffen und die am meisten Betroffenen die Schwächsten sind: Haushalte mit geringen Ressourcen, Frauen, ältere Menschen und Migrantengemeinschaften.“
Laut Lourdes Benavides, Leiterin der Abteilung für Klimagerechtigkeit der Organisation, „war dies ein klares Zeichen für die Notwendigkeit, sowohl beim gerechten Energiewandel als auch bei Anpassungsplänen, die niemanden zurücklassen, Fortschritte zu erzielen.“
VorschlägeDie Nichtregierungsorganisation ist der Ansicht, dass eine Steuer von 60 % auf das Gesamteinkommen des reichsten 1 % die Kohlenstoffemissionen reduzieren und rund 6,4 Billionen Dollar einbringen könnte.
Außerdem wird vorgeschlagen, Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie von der Teilnahme an Klimaverhandlungen wie der COP auszuschließen und stattdessen die Präsenz der Zivilgesellschaft und indigener Gruppen zu stärken.
Zu ihren weiteren Vorschlägen gehören ein gerechter Umgang mit dem verbleibenden Klimabudget, die Sicherstellung ambitionierter Klimafinanzierungen durch wohlhabende Länder und der Aufbau eines gerechten Systems – „Ablehnung der dominanten neoliberalen Wirtschaftspolitik und Hinwendung zu einer auf Nachhaltigkeit und Gleichheit basierenden Wirtschaft“ –, die unter anderem eine Abkehr von dieser neoliberalen Wirtschaftspolitik und den Übergang zu einer auf Nachhaltigkeit und Gleichheit basierenden Wirtschaft vorsieht. EFEverde
nam/crf
efeverde